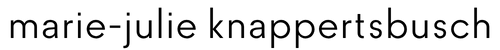Dankbarkeit
Dankbarkeit können wir in jedem Moment unseres Lebens praktizieren.
Manchmal fällt es nicht so leicht, wenn Widrigkeiten, Schicksalsschläge und Probleme das Leben triste erscheinen lassen.
Doch auch dann geht es uns eine kleines bisschen besser, wenn wir wenigstens ein paar Minuten am Tag den Dingen widmen, die positiv sind.
Das kann die frische Luft um uns herum sein, die wir einatmen. Der Boden, den wir unter unseren Füßen spüren. Das Zwitschern der Vögel oder das Gesicht eines geliebten Menschen.
Um in diesen Zustand der Dankbarkeit zu kommen, besinnt sich der eine auf die oben genannten Aspekte. Ein anderer geht in die Meditation, wieder ein anderer widmet sich der heiligen Schrift. Es geht ums Innehalten und sich besinnen - der Dinge die gut sind, aber auch der Möglichkeiten, die es noch gibt, gut zu werden.
Denn nicht nur bringt uns diese Übung in den aktuellen Moment, in dem meist alles gut ist, und das Problem gar nicht seine Klaue zeigt. Weiterhin bringen wir unser Bewusstsein auf eine Ebene, auf der wir entspannen können, eine Pause vom Grübeln, ein Moment ohne Sorge. Das spendet Kraft und Zuversicht. Und dann kommt noch der Aspekt der Hoffnung hinzu - sei es durchs positive Denken, manifestieren oder beten.
Wir ebnen den Weg für die Möglichkeit, dass alles gut wird, alles gut ist.
Manchmal helfen keine Worte der Zuversicht, aber das Gefühl dessen kann man möglicherweise irgendwo in sich konservieren und in dunklen Momenten herausholen und sich an seinem Licht laben.
Und auch gegenseitig können wir uns dabei helfen dankbar zu sein. Indem wir es verbal ausdrücken, wenn uns jemand die Tür aufhält, den Vortritt lässt, ein Lächeln schenkt.
Denn die Dankbarkeit potenziert sich durch sich selbst und wo Dankbarkeit ist, ist auch etwas wofür man dankbar sein kann.
Alter und Gemeinschaft
Ein Freund von mir ist nicht im Westen groß geworden.
Er ist überrascht darüber, wie zahlreich es Altersheime in Deutschland gibt und, wie viele Menschen demnach nicht im Kreise ihrer Familie alt werden.
Das hat mich zum Nachdenken gebracht, hatte ich doch dieses Konzept bisher nie grundlegend hinterfragt.
Im Gegenteil, ich habe Altersheime als Errungenschaft und Vorteil des Sozialstaates gesehen, nicht als Nachteil dessen.
Der Mensch strebt nach der größtmöglichen Bequemlichkeit - dazu gehört vermutlich auch, sich nicht um die geistigen und körperlichen Bedürfnisse der alternden Eltern zu kümmern. Gibt es doch dafür Altenheime und Alltagsbetreuungen. Und wo Möglichkeiten bestehen, werden sie auch genutzt.
Wie soll man auch Vollzeit arbeiten, evtl. mit Kindern und sich gleichzeitig, womöglich noch als Einzelkind um die alt gewordenen Eltern kümmern. Oder?
Wie setzen wir selbst als Mensch aber auch als Gesellschaft Prioritäten, wenn es im allgemeinen um unsere Mitmenschen, im speziellen aber um unsere enge Familie geht?
Wir leben in Deutschland in einer Individualkultur. Es gibt so viele Singlehaushalte, wie noch nie zuvor. Die Globalisierung erlaubt es Familien auf der ganzen Welt verteilt zu leben. Nicht wenige sehen ihre Eltern nur ein paar wenige Male im Jahr. Das ist vielleicht in jungen Jahren schade. Tragisch wird es erst, wenn die Eltern in ein Alter kommen, in dem sie auf die Hilfe ihrer Kinder angewiesen wäre - so wie die Kinder es einst auf die Fürsorge ihrer Eltern waren.
„Ich habe es mir ja nicht ausgesucht geboren zu werden“ antwortet da manch einer trotzig.
Aber wir können uns aussuchen, wie wir leben wollen. Und dazu gehört es vielleicht auch, sich zumindest einmal Gedanken darüber zu machen, wie wir mit dem Alter umgehen wollen.
Zuhören
Unser Alltag ist geprägt vom Zuhören. Das Leben in einer Gemeinschaft ist überhaupt erst möglich dadurch.
Morgens, 7 Uhr: Der Wecker klingelt, das Radio geht an: Neuigkeiten aus aller Welt, Wetter, Staubericht.
Bei der Arbeit der Austausch mit der Kollegin, in der Uni mit den Kommilitonen.
Was ist am Wochenende passiert? Lynn erzählt von ihrem Trip in die Alpen, Johannes musste beim anstrengenden Umzug helfen.
Teambesprechung, Aufgabenverteilung, Vorlesung, Seminar, Mensa.
Nachmittags in den Supermarkt, zum Arzttermin, danach zum Sport - überall treffen wir auf Menschen, die uns etwas zu sagen haben, die uns wichtige Informationen mitteilen, denen wir besser aufmerksam folgen.
Zuhören als Pflichtprogramm - da ist es nicht verwunderlich, dass es bei vielen Menschen kein Halten zu geben scheint, wenn sie auf einen aufmerksamen Zuhörer treffen.
Dann wird beim Sport mit der Freundin detailliert das letzte Zusammentreffen mit dem Schwarm dargelegt, beim Date mit einer neuen Bekanntschaft der ausschweifende Abend vom Wochenende seziert und beim gemeinsamen Abendessen mit den Kollegen im letzten Urlaub geschwelgt - und sobald man sich versieht ist die gemeinsame Zeit vorbei, ohne, dass man selbst viele Wort gesagt oder Gedanken geteilt hat.
Hat die vielbeschäftigte Freundin kein Interesse an mir? Bin ich meinem Date zu langweilig?
Meist liegt es gar nicht an uns, dass der Andere uns nicht die Aufmerksamkeit zuteil kommen lässt, die wir gerne bekämen.
Vielmehr freuen sie sich wahrscheinlich, dass ihnen jemand zuhört. Und vielleicht können wir es auch so sehen: Zuhören als Geschenk, das wir einem anderen machen. Als Fähigkeit, die wir ausbauen und vielleicht sogar ein wenig als Achtsamkeitsübung, die wir in unserem Alltag praktizieren können.
Kirchenglocken
Die einen lieben, die anderen hassen sie - kaum etwas ist so polarisierend, wie das metallene Gusseisen, das sich am höchsten Punkt eines jeden christlichen Gotteshauses befindet und zu wiederkehrendem Ton erschwingt: die Kirchenglocke
Ausschlafen am Wochenende? Fehlanzeige, wenn man in unmittelbarer Nähe zu einer Kirche wohnt, die mittels Glocke zum Gottesdienst einlädt.
Gegen dieses, das sakrale, Läuten, kann man, so sehr man sich auch darüber ärgern mag, nichts ausrichten, da es der Religionsfreiheit unterliegt.
Anders sieht es beim Glockenschlag aus, der die Zeit ansagt - hier haben Gerichte entschieden, dass es sich an die Vorgaben des Emissionsschutzes halten muss. Dabei dürfen 30 Dezibel bei Tag und 20 Dezibel bei Nacht nicht überschritten werden.
Aber das Glockenläuten kann nicht nur als Ruhestörung oder als überholt ausgelegt werden.
Viele, auch nicht gläubige oder christliche Menschen, sehen in ihm etwas haltgebendes oder sogar heilsames. Das wiederkehrenden Glockengeläut ist ein Synonym für das Zusammenkommen einer Gemeinde. Auch die Ähnlichkeit der Frequenz zu z.B. der in der tibetischen Medizin angewandten Klangschalen, ist nicht zu verkennen. Es ist ein melodischer und angenehmer Klang, der in seiner Charakteristik bei keiner Kirche gleich ist. Glockengeläut verbindet uns akustisch mit unserer Umgebung und bietet Struktur im Alltag.
Ich selbst freue mich jedes Mal, wenn die Glocken bei mir im Haus klingeln. Auch, wenn es nicht meine Gemeinde ist, in deren Namen sie läuten.
Ich weiß dann, dass sich gerade Menschen aufmachen um einem wichtigen Ritual in ihrer Woche nachzugehen, ich mag den Klang und manchmal nehme ich sie mit dem Handy auf und sende sie an Menschen, von denen ich weiß, dass sie sich ebenfalls daran erfreuen.
Tiere essen
Wenn ich gefragt werde, wie lange ich schon vegetarisch bin, antworte ich, dass es kaum Phasen in meinem Leben gab, in denen ich es nicht war.
Meine Mama hatte immer schon eine Abneigung dagegen Fleisch zuzubereiten und ich gegen jeden lebendigen Bestandteil des Fleisches: zu viel Fett in der Salami, Knorpel im Fleisch oder - Gnade Gott - eine blaue Ader im Hühnchenfilet.
Nach einer rebellischen Phase während meiner Pubertät, als ich unbedingt mit meinen Freunden Burger in einer bekannten Fastfood-Kette essen wollte, legte sich mein Interesse daran Fleisch zu essen wieder - bis heute.
Ich konnte den Gedanken, ein Lebewesen zu essen nicht ertragen: hat doch in meinen Augen jedes Tier eine eigene Persönlichkeit, Daseinsberechtigung und Seele.
Kürzlich habe ich zum ersten Mal daran gezweifelt, ob ich damit das richtige tue.
Seit ich mich mit „traditioneller“ Ernährung beschäftige ist die Überzeugung des Vegetarismus ins Wanken geraten.
So haben traditionelle Völker immer schon Fleisch in ihre Ernährung eingebunden und trotzdem (oder gerade deswegen?) ein spirituelles und naturnahes Leben geführt, in dem sie Mensch, Tier und Natur wertschätzen und würdigen.
Von Religion zu Religion finden wir unterschiedliche Antworten. Im Islam ist Schweinefleisch Tabu, außerdem sollte nach einem speziellen „Schlacht-Riten“ vorgegangen werden. Im Buddhismus soll das Leben geschützt werden und im Christentum dürfen laut Bibel wiederkäuende Tiere mit gespaltenen Klauen gegessen werden. In Letzterem gibt es jedoch auch Theorien, dass das ursprünglich, als der Mensch noch im Paradies weilte, nicht so vorgesehen war. Hier sollte sich von Samen und Pflanzen ernährt werden. Erst als der Mensch aus dem Paradies vertrieben wurde, wird das Fleischessen legitimiert.
Sonntagsruhe
Sonntagsspaziergang, Wäsche waschen, telefonieren und einfach faul von der Woche erholen. Spätestens als das Abendessen ansteht, wird es knifflig: Ich werfe einen Blick in den - leeren - Kühlschrank.
Zerknirscht schließe ich ihn wieder. Was nun? Zum 20 Minuten entfernten Bahnhof und da aus der spärlichen Auswahl des überteuerten To-Go Supermarktes ein Dosen-Menü zaubern? Zu fad.
Es bei Nudeln und Olivenöl belassen? Zu eintönig.
Einfach gar nicht zu Abend essen? Keine Option.
Der Sonntagsblues schlägt zu: kein Supermarkt hat geöffnet um mich aus den Konsequenzen meiner arbeitsreichen Woche zu retten: in der ich mal wieder das Einkaufen vergessen habe.
Natürlich habe ich es vergleichsweise gut, besser als viele Menschen - ich muss nicht hungern. Und trotzdem frage ich mich, ob ein geschlossener Sonntag überhaupt noch zeitgemäß ist.
Ursprünglich religiös motiviert, da Gott in der Schöpfungsgeschichte am siebten Tag ruht, diesen Tag heiligt und segnet, sollte der freie Sonntag als „Tag des Herrn“ und als Tag der Auferstehung Christi, die auf einem Sonntag lag, den Besuch der Sonntagsgottesdienste ermöglichen.
Sonntag ist also frei - aber mit Ausnahmen: Zum Glück, stelle ich fest! Denn was wäre, wenn Pflege, Polizei, Transportunternehmen oder der öffentlichen Nahverkehr auf ihre Sonntagsruhe bestehen würden?!
Puh, also ganz schön viele Menschen, die am Sonntag doch arbeiten müssen.
Ich muss es nicht. Dafür bin ich sehr dankbar, besinne mich darauf, wie gut ich es habe, mache es mir mit meinen Nudeln auf der Couch gemütlich und bin froh, nach einer hektischen Woche zur Ruhe kommen zu können.
- Hinter fünf halbleeren Marmeladengläsern hatte sich sogar noch ein vertrocknetes Stück Parmesan im Kühlschrank versteckt. Was für ein Segen.